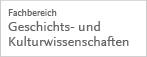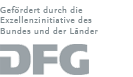Hannah Schünemann

Ultrawelten. Radikale Formsprachen in den Inszenierungen von Susanne Kennedy, Lucia Bihler und Florentina Holzinger
Raum JK 33/136
14195 Berlin
Hannah Schünemann ist Dramaturgin, Literatur- und Theaterwissenschaftlerin und seit Oktober 2021 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Exzellenzcluster "Temporal Communities" tätig, wo sie bei Prof. Dr. Doris Kolesch zu radikalen Formsprachen im Gegenwartstheater promoviert.
Sie studierte im Bachelor Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Theaterwissenschaft in München (LMU) und in Paris (Université Paris-Sorbonne IV). Ihr Masterstudium an der FU Berlin und École normale supérieure Paris schließt sie 2016 mit einer Arbeit über Verstehenstheorien bei Peter Szondi, Jacques Derrida und Paul Celan ab.
Von August bis November 2023 war sie Gastwissenschaftlerin im PhD Program for Theatre and Performance am Graduate Center der City University New York.
Als Dramaturgin und Kulturschaffende arbeitete sie u.a. an der Volksbühne Berlin, für die Berliner Festspiele, das Performing Arts Festival und am Ballhaus Ost.
Sommersemester 2021: Proseminar Theorie und Geschichte zusammen mit Prof. Dr. Gabriele Werner "Dekolonisieren" / "Mein Zimmer, meine Heimat, meine Welt" (kunsthochschule weißensee, Kulturwissenschaft)
Vorträge (Auswahl)
„Kritische Nähe – subjektlose Kritik: Perspektiven mit Brecht auf Techniken des Gegenwartstheaters.“ Vortrag zusammen mit Felix Stenger im Rahmen des 17. Symposiums der International Brecht Society, Tel Aviv, 12.12.2022.
„Kritik durch Nähe: Perspektiven mit Brecht auf Techniken des Gegenwartstheaters.“ Vortrag zusammen mit Felix Stenger im Rahmen des 15. Kongress der Gesellschaft für Theaterwissenschaft „Matters of Urgency“, FU Berlin, 30.09.2022.
“How Worlds are Built in Contemporary German Theatre.” Vortrag am Marymount Manhattan Collage, New York City, 26.10.2023
„Radical Languages of Form in Contemporary German Theatre.” Vortrag im Rahmen des Greenroom Programms am Program Theatre and Performance, Graduate Center, City University New York, 01.11.2023
Dissertationsprojekt
Ultrawelten. Radikale Formsprachen in den Inszenierungen von Susanne Kennedy, Lucia Bihler und Florentina Holzinger (Arbeitstitel)
In der globalisierten und digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts ist die Verarbeitung von Information, die Anforderung an Wahrnehmung ambivalenter und vielfältiger geworden. Die Bandbreite an technischen Möglichkeiten und medialen Konstellationen eröffnet Zugänge zu neuen Erlebniswelten, gleichzeitig verweist sie auf eine Vielzahl von Brüchen mit unserer gewohnten Perspektive. Längst schon zeigen sich vor diesem Hintergrund neue und andere Formen des Erzählens, die seit Beginn der 2010er Jahre auch zunehmend in der Darstellenden Kunst an Bedeutung gewinnen. Im theatralen Kontext betrifft diese Veränderung nicht nur den Text als Medium des Erzählens, sondern diverse Medien, Materialien und Techniken, die an der Transformation gemeinschaftlicher Narrative auf der Bühne beteiligt sind. Umso mehr müssen Transformationen im Theater des 21. Jahrhunderts als vielschichtige Modellierungprozesse verstanden werden, deren formgebende Bestandteile als „travelling matter“ für die Kritik und den Wandel überkommener Strukturen ausschlaggebend sind.
In ihrem Forschungsprojekt widment sich Hannah Schünemann, anhand der Arbeiten der Regisseurinnen Susanne Kennedy und Lucia Bihler, sowie der Choreographin Florentina Holzinger, einer jungen Künstler*innen-Generation, die paradigmatisch für einen formalen Wandel in der Darstellenden Kunst seit den 2010er Jahren steht, sich von den Ästhetiken der vorausgegangenen Jahrzehnte und dem Status Quo der Postdramatik ablöst. Im Fokus der Analyse steht dabei die formale Komposition der Inszenierungen, ihre körperlichen, technischen, materialen und medialen Bestandteile und deren Zusammenwirken. Für die Betrachtung performativer Körper auf der Bühne bildet dabei die Geste das theoretische Fundament der Beschreibung. Ausgehend von Judith Butlers Definition folgt das Projekt einem partiellen Querschnitt durch die Theoriegeschichte der Geste zu Brecht, Kafka, Benjamin und Derrida und arbeitet mögliche Übereinstimmungen und Widersprüche zu den Formsprachen des 21. Jahrhundert heraus. Mit Blick auf die Art und Weise wie tradierte theatrale Elemente im Prozess ihrer Zirkulation und Übertragung ausgestellt, dekontextualisiert, verschoben und verändert werden, legt das Forschungsprojekt den Schwerpunkt auf die Beschreibung und begriffliche Theoretisierung aktualisierter Weltentwürfe auf der Bühne. Und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Auseinandersetzung Kennedys, Holzingers und Bihlers mit herkömmlichen Darstellungsweisen – deren Revidierung und Aktualisierung –, die sich in den komplexen Formsprachen aller drei Künstlerinnen zeigt. Die Verknüpfung der Künstlerinnen innerhalb des Forschungsprojekts führt dabei theaterästhetische Betrachtungen mit Fragen des Posthumanismus und Zusammenspiels von Mensch und Natur nach dem Anthropozän, der Genderperformativität und Handlungsermächtigung, der Medienkonkurrenz und der Dissoziation des Individuums im Zeitalter der Digitalisierung zusammen. Damit zielt das Projekt auf einen Beitrag zum umfassenderen Thema des Forschungsbereich 2 ab und lotet das kritische Potential einer transmedialen und -materialen Theaterästhetik des 21. Jahrhunderts aus.
Weitere Forschungsschwerpunkte
Dramatik der Gegenwart
Französische Avantgarde des 20. Jahrhunderts
Literaturtheorien der Dekonstruktion und des Poststrukturalismus
Philologisches Denken bei Peter Szondi und Paul Celan
Zäsuren und Negation in Verstehenstheorie und literarischer Hermeneutik
Gendertheorie und intersektionaler Feminismus