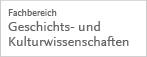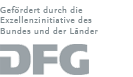Susanne Kaiser
Alumna
Körper und Erzählen bei Tahar Ben Jelloun und Assia Djebar
[Stand 2015]
Monografien
Kaiser, Susanne 2015. Körper erzählen. Der postkoloniale Maghreb von Assia Djebar und Tahar Ben Jelloun. Bielefeld: Transcript.
Aufsätze
Kaiser, Susanne 2013. „Körper und Erzählen: Zur Inszenierung mündlicher Erzähltradition in Tahar Ben Jellouns L’enfant de sable“. In: Alexandra Strohmaier (Hg.). Kultur – Wissen – Narration. Perspektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die Kulturwissenschaften. Bielefeld: Transcript, S. 445–458.
Kaiser, Susanne 2011. „Vom Körper als Medium zum Medium des Textes – Körpersprache als narrative Strategie in Tahar Ben Jellouns L’enfant de sable“. In: Jens Elze et al. (Hg.). Möglichkeiten und Grenzen der Philologie. Berlin: GiNDok – Publikationsplattform Germanistik, S. 89–103.
Rezensionen
Kaiser, Susanne 2010. „Rezension zu Michael F. Klinkenberg: Das Orientbild in der französischen Literatur und Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum fin de siècle“. In: OLZ – Orientalistische Literaturzeitung, 105 (6), S. 764–770.
Vorträge
Embodying Society - Body Techniques in Postcolonial Maghrebian Literature: Assia Djebar's 'Body Poetics'. In: 31. Deutscher Orientalistentag: Spiegelungen, Projektionen, Reflexionen. Marburg 20.-24.09.2010 (noch nicht erschienen).